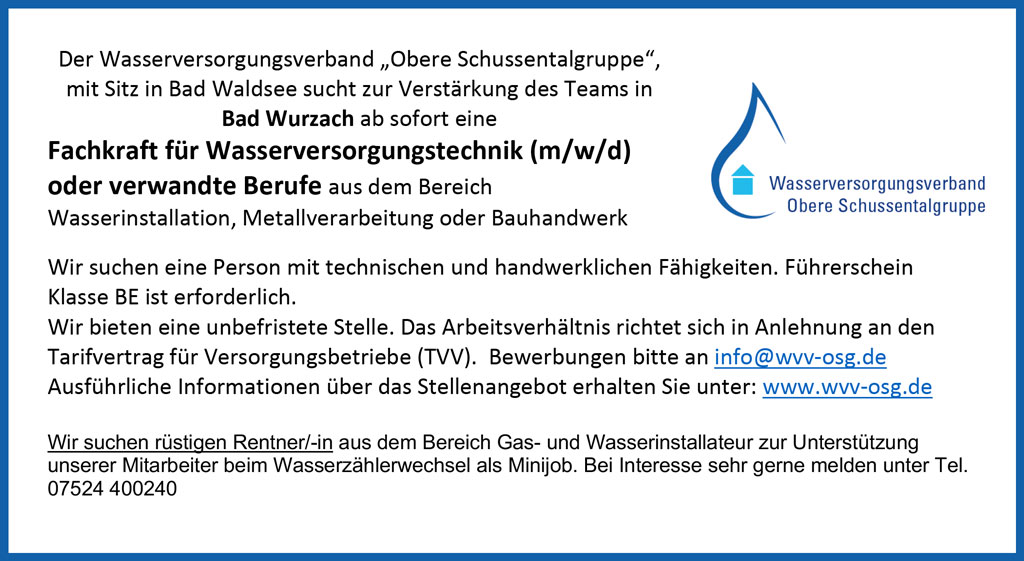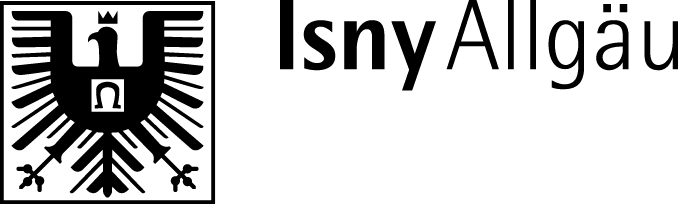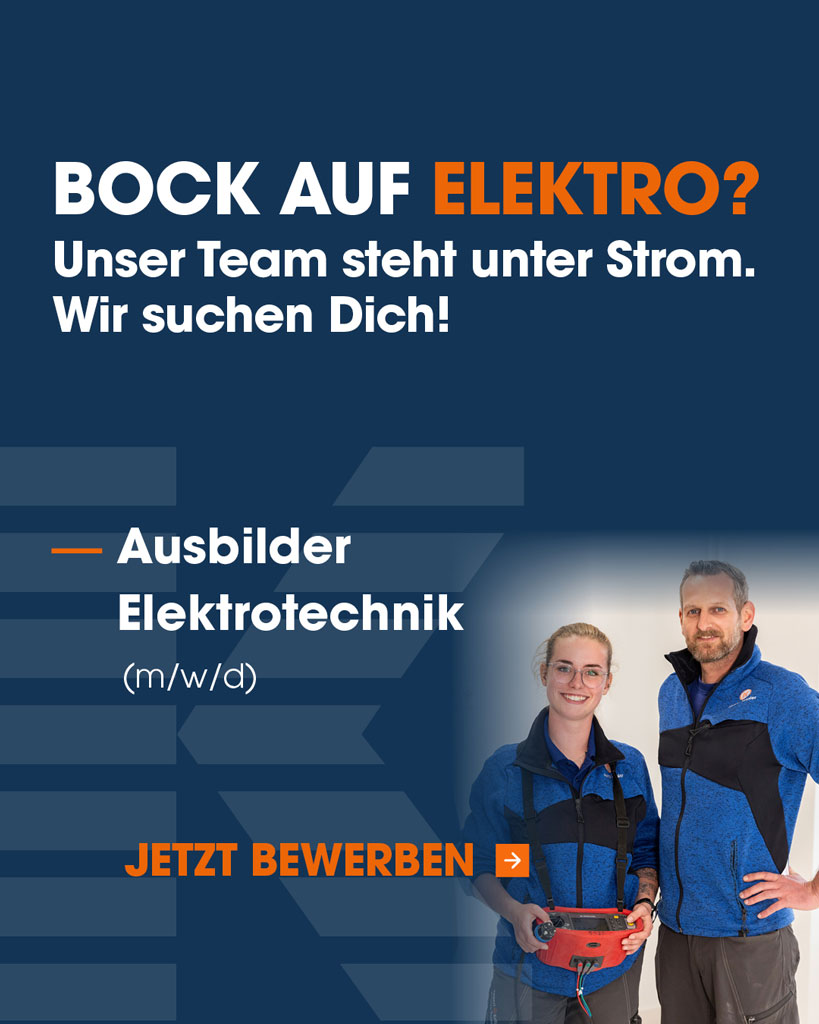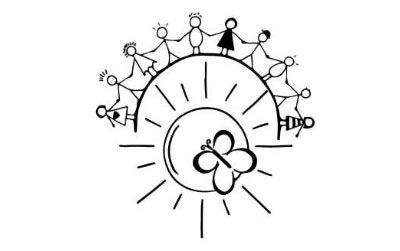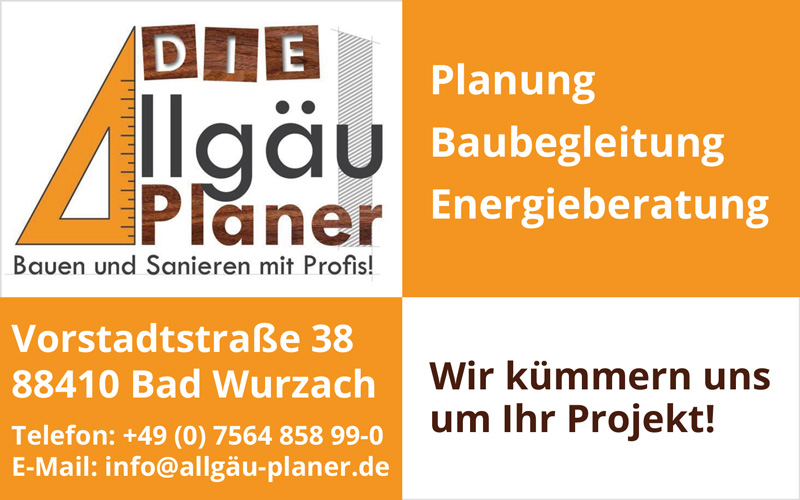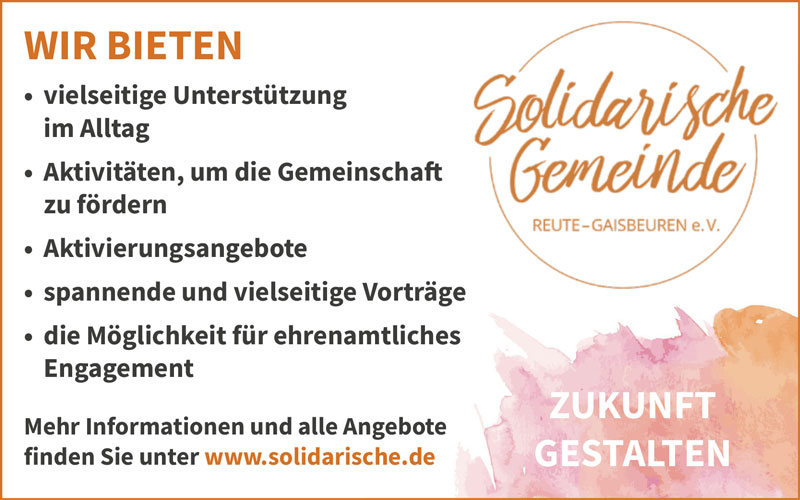Die Verfahren gegen Otto Siebler
Diepoldshofen – Heimatforscher Artur Angst (1914 – 1992) befasst sich in seiner Ausarbeitung von 1982 zum Diepoldshofer Soldatengrab auch mit den Ermittlungsverfahren gegen Otto Siebler, jenen Hauptmann, der am 26. April 1945 den Befehl zur Hinrichtung von 15 deutschen Soldaten im Wald zwischen Diepoldshofen und Bauhofen gegeben hatte – zwei Tage vor dem örtlichen Kriegsende. Die Zwischentitel im Artikel wurden von der Redaktion der Bildschirmzeitung eingefügt. Hier Teil 5 (Schluss) unserer Serie, die wir in der Bildschirmzeitung am 22. April begonnen haben:
Jeder, der von den Vorgängen des 26. April 1945 im Diepoldshofer Wald hört, fragt sich erschüttert: Mussten diese fünfzehn zum Tod verurteilten Gefangenen wenige Tage vor Kriegsschluss noch sterben? Wäre es nicht möglich gewesen, die Hinrichtung vollends bis zu diesem Ereignis hinauszuzögern, ein Ereignis, das die Situation für die gefangenen Soldaten entscheidend verändern musste und den zum Tod Verurteilten hätte das Leben retten können?
Das Verfahren von 1950 (der Fall Wolange)
Eines ist inzwischen klar geworden: Der Vorwurf gegen Siebler, er habe die im Diepoldshofer Wald Hingerichteten ohne Vollstreckungsbefehl und nach willkürlicher Auswahl erschießen lassen, er sei also zum Mörder an den fünfzehn Toten geworden, lässt sich nicht aufrechterhalten. In zwei Ermittlungsverfahren hatte sich das herausgestellt. Das eine lief 1950 vor der Staatsanwaltschaft Bochum. Die Schwester des erschossenen Heinrich Wolange hatte im Februar 1948 von einem Heimkehrer erfahren, ihr Bruder sei bei Diepoldshofen auf Befehl eines deutschen Offiziers erschossen worden.14a Sie erstattete schließlich am 16.3.1950 bei der Kriminalpolizei Essen Anzeige gegen Unbekannt wegen Verdachts des Totschlags an ihrem Bruder. Das zog ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Bochum nach sich, bei dem schließlich Otto Siebler als der Beschuldigte ermittelt, aber das Verfahren am 30.8.1950 eingestellt wurde, weil es sich bei der fraglichen Exekution um eine ordnungsgemäße Vollstreckung eines rechtsmäßig zustandegekommenen Todesurteils gehandelt habe.

Das Verfahren von 1953/1957 (der Fall Krüger)
Ein zweites Verfahren gegen Siebler war 1953 in Gang gekommen. Der in Solingen wohnende Siegfried Krüger, ein Bruder des hingerichteten Heinz Krüger, war von der deutschen Dienststelle Berlin-Wittenau im Frühjahr 1953 benachrichtigt worden, dass sein Bruder erschossen worden sei. Die genannte Dienststelle hatte im Januar 1953 die Erkennungsmarken, die man bei sieben der im Diepoldshofer Wald Hingerichteten gefunden hatte, entschlüsseln können und, soweit möglich, die Angehörigen der Toten angeschrieben. Siegfried Krüger erstattete im Mai 1953 bei der Kriminalpolizei Solingen Anzeige gegen Unbekannt, weil sein Bruder zu Unrecht hingerichtet worden sei.20. Diese Anzeige wurde am 3.8.1953 an das Kriminalkommissariat Ravensburg weitergegeben, nachdem in Solingen festgestellt war, dass die Erschießung in Diepoldshofen stattgefunden hatte. Da weder in Solingen noch in Ravensburg das 1950 in Bochum durchgeführte Verfahren gegen Siebler bekannt war, blieben die Ermittlungen nach dem Verantwortlichen zunächst ohne Erfolg. Erst im Mai 1954 kamen die Ermittelnden auf den Namen Otto Siebler und dessen Wohnort Witten/Ruhr und bei den daran anschließenden Nachforschungen in Witten auf das 1950 durchgeführte Ermittlungsverfahren in Bochum.

Unabhängig von dem dortigen Verfahren ermittelte man in Ravensburg sehr eingehend weiter. Nach rund zweieinhalb Jahren wurde dann auch dieses Verfahren gegen Siebler eingestellt, weil dem Angeklagten – er war Stadtinspektor in Witten – eine Schuld im juristischen Sinn nicht nachzuweisen war. Die Schlusssätze der Einstellungsverfügung vom 8.1.1957 sprechen das deutlich aus: „Nach diesem Ermittlungsergebnis kann dem Beschuldigten Siebler nicht widerlegt werden, dass es sich bei den von ihm durchgeführten Erschießungen um eine ordnungsgemäße Vollstreckung rechtskräftiger Todesurteile gehandelt hat, die auf Befehl des mit dem Vollzug betrauten Wehrmachtsgerichtes erfolgt ist, zumal im Laufe des Verfahrens nichts bekannt geworden ist, was darauf schließen ließe, dass Siebler ein zu Willkürakten neigender Offizier war, dem ein derartiges Verbrechen, nämlich die willkürliche Erschießung von 15 ihm anvertrauten Soldaten, zuzutrauen wäre. Ein strafrechtliches Einschreiten gegen Siebler war unter diesen Umständen nicht möglich. Das Verfahren musste deshalb eingestellt werden.“15
Zwei Tage vor dem örtlichen Kriegsende
Es bleibt aber die zuvor schon gestellte Frage: Hätte Siebler den Vollzug der Hinrichtung nicht vollends bis zum Kriegsende hinauszögern können?16
Die Frage ist leicht gestellt. Ein entsprechendes Verhalten aber hätte für Siebler, nachdem er die Vollstreckung bereits sechs Tage hinausgeschoben hatte, mit Sicherheit bedeutet, den eigenen Kopf zu riskieren. Hätte man das von ihm verlangen können, zumal es sich um Soldaten handelte, die in einem ordnungsgemäßen Kriegsgerichtsverfahren eines nach damaliger Auffassung schweren Vergehens schuldig befunden und verurteilt waren?
Wenn man schon bei anderen die Schuld am Tod dieser fünfzehn deutschen Soldaten suchen will, dann gilt es, die Richter am Kriegsgericht des AOK 19 zu fragen. Sie haben die Todesurteile ausgesprochen, sie haben nach Bestätigung von sechzehn der Urteile durch den Oberbefehlshaber der 19. Armee den Vollstreckungsbefehl gegeben. Siebler war Vollzugsorgan, der einen schaurigen Auftrag auszuführen hatte, dessen Rechtsgrundlage für ihn außer Zweifel stand. Die fett gedruckte Überschrift in der „Revue“: „Fünfzehn deutsche Soldaten wurden … auf Befehl des Hauptmanns Siebler heimlich hingerichtet“ ist unzutreffend und eine unerlaubte Vorwegnahme eines Urteils, das vom Gericht erst noch gefunden werden musste und das schließlich ganz anders lautete, als es „Revue“ ihren Lesern suggerieren wollte.
Es scheint, dass Siebler nach dem Abmarsch aus Waldkirch, als noch kein Vollstreckungsbefehl vorlag, Hoffnung hatte, dieser grausigen Aufgabe nicht nachkommen zu müssen. Vielleicht glaubte er sogar noch nach dem 19. April, als er Befehl zur Hinrichtung von 16 Verurteilten bekommen hatte, dass die Ungunst der Lage die Ausführung des Befehls verhindern könnte. Nachdem aber in Diepoldshofen eine zweitätige Marschpause eingelegt war (möglicherweise mit Wissen und Willen des Kriegsgerichts des AOK 19?), konnte er fehlende Gelegenheit für eine Exekution nicht mehr vorschützen, für ein weiteres Hinausschieben der Hinrichtung hätte es kaum mehr glaubhafte Gründe gegeben, der Aufschub hätte fast unverhüllt das Siegel der Befehlsverweigerung getragen. Ob Siebler dann nicht sehr schnell selbst verhaftet worden wäre und an seiner Stelle ein anderer die Exekution durchgeführt hätte?
Nicht wenige deutsche Soldaten, die das Kriegsende 1945 erlebt haben, wissen, in welche Gewissenskonflikte man damals kommen konnte. Nicht ausgeschlossen, dass das auch Siebler in jenen Tagen an sich selbst erfahren hat.
Artur Angsts Schlussbemerkung
Unser Mitgefühl wendet sich spontan den fünfzehn Hingerichteten zu. Freilich, sie waren nach dem Militärgesetz schuldig geworden, „meist wegen Wehrkraftzersetzung, Fahnenflucht oder ähnlicher Gründe zum Tode verurteilt“, wie „Revue“ angibt. Das sind aber nur ein paar allgemeine, summarische Hinweise. Was kann mit „ähnlichen Gründen“ gemeint sein? Etwa Sabotage, Verrat, Unterschlagung und Verschiebung kriegswichtiger Güter? Wir wissen es nicht. Nur Einsicht in die Kriegsgerichtsakten des AOK 19 könnte Klarheit verschaffen, sofern die in Frage kommenden Akten überhaupt noch vorhanden sind.17 In einem einzigen Fall, dem des Heinz Krüger, wissen wir, dass er fahnenflüchtig geworden war. Fahnenflucht wurde und wird bei allen Armeen der Welt hart geahndet, das liegt in der Natur der Sache.
Indes: Heinz Krüger und die mit ihm Hingerichteten haben für ihre Schuld schwer gebüßt, eine Schuld zudem, die man bei jedem von ihnen hinterfragen müsste. Die Toten im Diepoldshofer Wald gehören zu den Millionen im Krieg umgekommener Soldaten und diese wiederum zu den Millionen sonstiger Kriegstoter, die uns ständig mahnen, alles zu tun, um den Frieden zu sichern. „Vor Pest, Hunger und Krieg bewahre uns Herr Jesus Christus!“, so lautet ein alter Gebetsruf. Die Menschheitsgeißel Pest wurde inzwischen gebannt. Wird es auch mit den beiden anderen apokalyptischen Reitern gelingen? Jedermann ist aufgerufen, dazu beizutragen.
Artur Angst, März 1982
Fußnoten
14a) Information der Staatsanwaltschaft Ravensburg vom 10.2.82.
15) Siebler wurde siebeneinhalb Jahre später am 31.8.1964 wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand versetzt. Knapp zwei Jahre danach wurde er beim Landeskriminalamt Ludwigsburg noch einmal angezeigt (25.5.1966) wegen Erschießungen von Insassen des Heeresgefängnisses des AOK 19 am 21.1., 10.4. und 11.4. (vermutlich 1945; Anm. der DBSZ-Red.) in Waldkirch, Hinrichtungen also, die vor dem Abmarsch des Heeresgefängnisses aus Waldkirch stattgefunden hatten. Siebler bestritt, dass in diesen Fällen er selber das Exekutionskommando geführt habe. Das Ermittlungsverfahren vor der Staatanwaltschaft Freiburg i. Br. wurde am 28.11.1967 ebenfalls eingestellt, weil man Siebler keinen strafrechtlichen Vorwurf machen konnte und es sich bei den genannten Exekutionen um die Vollstreckung rechtmäßig zustandegekommener und vom Gerichtsherrn bestätigter Todesurteile gehandelt hatte. Bei diesem Verfahren war dem Beschuldigten von Angehörigen seiner ehemaligen Einheit erneut verantwortungsvolles Handeln und unbedingte Korrektheit bescheinigt worden.
Siebler zog Ende 1969 von Witten nach Köln, wo er eindreiviertel Jahre später am 15.9.1971 verstarb.
16) Die Kapitulation der Heeresgruppe G, d.h. des Südteils der Westfront, erfolgte am 4. Mai 1945, also 8 Tage nach der Exekution, in Haar bei München. Damit hätte sich, wie schon gesagt, für die Verurteilten wohl sicher eine günstigere Situation ergeben.
17) Die entsprechenden Akten scheinen nicht mehr zu existieren, da sonst die Staatsanwaltschaft Ravensburg wohl nicht versäumt hätte, sie als mögliche Auskunftsquelle im Fall Sieblers heranzuziehen.
18) Siehe Folge 4 unserer Serie
19) Siehe Folge 4 unserer Serie
20) Der hingerichtete Heinz Krüger war, wie erwähnt, fahnenflüchtig und von seiner Mutter ein Jahr lang versteckt gehalten worden, bis er schließlich entdeckt wurde und vor ein Kriegsgericht kam. Er wurde am 30.10.1944 zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt, aber sofort begnadigt und einer Bewährungskompanie zugeteilt. Nur diese Tatsachen waren damals, Mai 1953, dem Anzeige erstattenden Bruder Siegfried bekannt. Dass dieser zum genannten Zeitpunkt noch nichts von einem zweiten Kriegsgerichtsverfahren gegen seinen Bruder Heinz wusste, lässt sich aus der Situation im Frühjahr 1945 erklären, wo eine Benachrichtigung der Strafregisterbehörden und der Angehörigen praktisch unmöglich geworden war. Heinz Krüger war bei der Bewährungskompanie offenbar zum zweiten Mal in gravierender Weise straffällig geworden, was ein neues Verfahren und seine Verurteilung zum Tode nach sich gezogen haben muss. Vgl. dazu die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Ravensburg vom 8.1.1957.
Folge 1 der Serie erschien in der Bildschirmzeitung am 22. April unter dem Titel „Zu den Erschießungen am 26. April 1945“
Folge 2 der Serie erschien in der Bildschirmzeitung am 23. April unter dem Titel „Von Waldkirch (Baden) zur Hinrichtung in Diepoldshofen“
Folge 3 der Serie erschien in der Bildschirmzeitung am 24. April unter dem Titel „Als Otto Siebler Vollzug melden wollte, war keiner mehr da”
Folge 4 der Serie erschien in der Bildschirmzeitung am 25. April unter dem Titel „Die heutige Grabstätte stammt von 1959“
Das Typoskript von Artur Angst
Das gesamte Typoskript von Artur Angst aus dem Jahre 1982 finden Sie hier in der Bildschirmzeitung am Ende des Artikels unter “Downloads”.