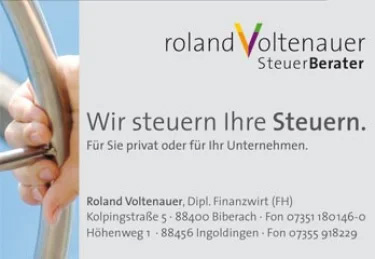Ravensburg – Die Ausstellung mit Skulpturen, Plastiken und Zeichnungen der polnischen Künstlerin Alina Szapocznikow ist persönlich bis zur Schmerzgrenze. Die Kuratorinnen Ute Stuffer, Direktorin des Museums, und Prof. Ursula Ströbele haben ihr den Titel „Körpersprachen“ gegeben.
Ein „Zubehör“ jedes Menschen, das wir in der Masse meist gar nicht bewusst wahrnehmen. Den Stolz des Zimmermanns vielleicht, in seiner traditionellen Kluft, die inszenierte Coolness von Jugendlichen in ihren Puff-Daddy-Klamotten, der von Arbeit gekrümmte Rücken einer alten Bauersfrau. Es gibt Körpersprachen, die, vordergründig zumindest, nichts verbergen, die eine Lebensgeschichte erzählen, von Arbeit auf dem Bau, von der „Körperlosigkeit“ in einem Büro. Es gibt Körpersprachen, die ein soziales Milieu repräsentieren, dezent wie auffällig, individuell wie kollektiv. Die Körpersprachen am Kölner Hauptbahnhof unterscheiden sich fundamental von denen im Arbeiterviertel Köln Nippes oder dem Villenviertel Mariental.
Da sind die äußeren Körpersprachen, die Anpassung bedeuten, an Mode, an Konsumgebaren oder Ablehnung, Widerstand, die Kultfiguren kreieren, Ikonen der Selbstvermarktung. Bekanntestes Beispiel der Designer Harald Glööckler. Und es gibt die inneren Körpersprachen, die einen Menschen in seiner ganzheitlichen Körperlichkeit prägen. Erfüllung und Glück, verdrängte, verschwiegene, traumatische, oft nur vordergründig bewältigte Geschichten.
Menschlichen Körpern in existentieller Bedrohnung, zerbrechlich, fragil, bedroht, begegnet Alina Szapocznikow sehr früh. Sie wird 1926 in dem kleinen Ort Kalisz in eine polnisch-jüdische Arztfamilie geboren. Mit 14 Jahren erlebt sie die Enge, den Hunger, das Ghetto von Lodz. Dann wird sie nach Auschwitz, von dort nach Bergen-Belsen und nach Theresienstadt transportiert, überlebt die Körpersprache des männlichen autoritären Charakters, in seiner geradezu lustvollen Sucht nach Zerstörung. Mit 18 Jahren wird prägend die Befreiung von Theresienstadt durch sowjetische Truppen. Sie studiert in Prag und Paris Bildhauerei, kehrt 1951 für über zehn Jahre nach Polen zurück. Nach der Hölle deutscher KZs hat sie die Hoffnung, dass in ihrer Heimat eine bessere Welt entstehe. In der Kunst allerdings beginnt sie nicht, die hat der Kommunismus gekapert. Sozialistischer Realismus heißt die neue Doktrin. Dennoch schafft sie zwei großartige Entwürfe, die auch in Ravensburg zu sehen sind: eine metallene Hand mit einem Loch, einer Wunde in der Mitte. Wie ein Schrei, wie ein Befreiungsakt wirkt dieser Entwurf für ein nicht realisiertes „Mahnmal für die Helden von Warschau“; zwei Hände für ein ebenfalls nicht realisiertes Mahnmal für Auschwitz-Birkenau. Sie gestaltet 1956 die Bronzeskulptur einer jungen Frau mit winzigen Brüsten, einem Pferdeschwanz, eine Hand in die Hüfte gestützt – provokativ modern, mit der Tradition der sowjetischen Heldenmütter brechend.

1963 kehrt sie nach Paris zurück, in der Auseinandersetzung mit Surrealismus und Pop-Art wird sie zum Star der französischen Avantgarde. Die Arbeiten haben etwas radikal Feministisches, sie entlarvt, sie decodiert die Gewalt an Frauen, die Kommerzialisierung, die sexualisierte Ausbeutung: da werden ein paar Brüste wie männliche Spielsachen in Polyesterschaum montiert; in der Skulptur „Goldfinger“ sind zwei weibliche Oberschenkel auf eine Autoachse montiert; in der „Fleischigen Maschine“ hat eine dreibeinige Skulptur statt eines Kopfes eine Drehscheibe. Die serielle Produktion von Frauen, die austauschbare Accessoires sind als Flugbegleiterinnen, für Luxustaschen, für Modeshows mit dem Dior-Gang, dem Smile für Gucci, den Beinen für Versace und einem Lifting für Chloé. Etliche der weiblichen Skulpturen sind aufrecht, ungebeugt, haben ein Geheimnis in sich; die Mehrheit aber ist verletzlich und verletzt, die Körper sind fragmentiert. Die ganze Ausstellung ist zutiefst verstörend, den Besuchern sehr persönliche Assoziationen weiblicher Körpersprachen ermöglicht; sie ist eine Herausforderung, und das ist gut so.
Alina Szapocznikow starb bereits 1973 mit nur 47 Jahren in Frankreich an Krebs. In ihrem „Autoportret“ von 1966 bleibt ihr Mund geschlossen. Bei all ihren Arbeiten bleibt der Mund geschlossen. Sie wollte nicht über die Gräueltaten, die sie erlebte, reden. Ihre Kunst aber sollte uns zum Reden bringen, über die Ungeheuerlichkeiten, die täglich an Frauen verübt werden. Millionen von Mädchen erleiden noch immer die unmittelbaren und die unterbewussten Schmerzen der Klitorisbeschneidung. Doch auch in Demokratien sind die Zeichnungen und Skulpturen nach fünfzig, nach sechzig Jahren erregende und bewegende Abstraktionen dessen, was Frauen angetan wird. 2023 gab es in Deutschland 938 Femizid-Versuche, Mordversuche also aus Frauenhass. 380 waren erfolgreich. Digitale Gewalt gegen Frauen hat alleine in 2023 um 25 Prozent zugenommen, so wie Sextourismus und Frauenhandel. 401 Frauenhäuser gibt es in Deutschland. Alle sind überfüllt. Die Arbeiten von Alina Szapocznikow im Kunstmuseum sprechen darüber.
Die Ausstellung läuft noch bis 6. Juli, Di – So, Öffnungszeiten unter: www.kunstmuseum-ravensburg.de
Autor: Wolfram Frommlet
NEUESTE BLIX-BEITRÄGE
BLIX Editorial Mai 2025
Gibt es ein Leben nach dem Dorf?
Wann bin ich alt?
„Ein dauerhafter Stachel“
Grenzen des Biosphärengebietes
Bis ans Ende
Der Bauernjörg, „die Blutsau“
Ganztagsschule für Grundschüler?
Zufriedenheit – ein zauberhafter Zustand
„Ich will wirken in dieser Zeit“
Hochsensibel oder überempfindlich?
Neu im Kino: Black Bag
Filmpreview: Karate Kid – Legends
Neu auf DVD & Blu Ray: Heretic
Making Of: “Dune 3” (2026)
BLIX-RUBRIKEN



BLIX-NEWSLETTER

BLIX-ARCHIV
VERANSTALTUNGEN